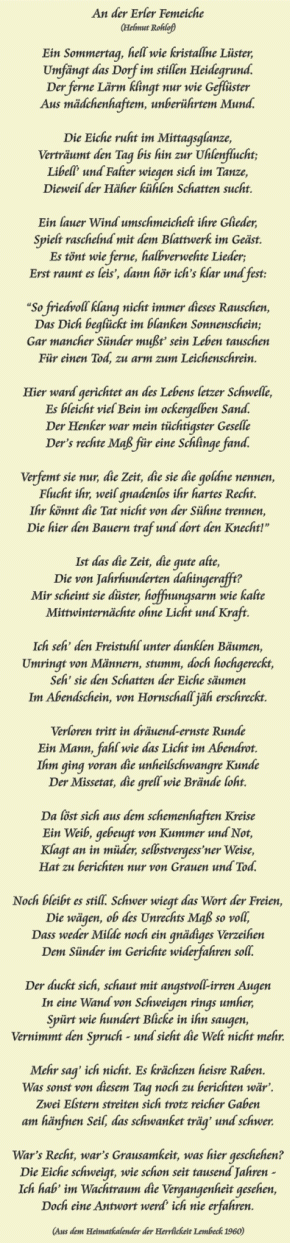|
|
| "Femeiche"
- Auch im Oktober 2008 noch am längsten "grün". Foto: Helmut Kölking, mit freundlicher Genehmigung |
|
|
| Eingangsbereich zur
Femeiche mit Stele. Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
 Der Stamm der Eiche ist völlig ausgehöhlt und bis auf drei
Stammteile, die sich in etwa vier Meter Höhe vereinen, zerstört. Die Eiche
ist entgegen der Hauptwindrichtung stark nach Südwesten geneigt [5]. Durch den schrägen Wuchs wurden die
Saftflussbahnen auf der geneigten Seite am Wurzelhals gequetscht, so dass etwa
ein Drittel des Stammumfangs abstarb [6]. Die
abgestorbenen Stammpartien wurden bei der Sanierung im Jahre 1965 entfernt.
Der Stamm besteht nur noch aus den äußeren Teilen des Splintholzes mit
Kambium, Bast und Rinde, die zum Teil nach innen eingerollt ist. Das Kernholz
ist nicht mehr vorhanden. Die früheren großen Äste sind nur noch in
Ansätzen zu erkennen. Weil sie überlang und kopflastig geworden waren,
brachen sie vor Jahrhunderten durch Sturm und Blitzschlag heraus. Von dem
immer morscher gewordenen tragenden Stamm brachen weitere Äste ab.
Der Stamm der Eiche ist völlig ausgehöhlt und bis auf drei
Stammteile, die sich in etwa vier Meter Höhe vereinen, zerstört. Die Eiche
ist entgegen der Hauptwindrichtung stark nach Südwesten geneigt [5]. Durch den schrägen Wuchs wurden die
Saftflussbahnen auf der geneigten Seite am Wurzelhals gequetscht, so dass etwa
ein Drittel des Stammumfangs abstarb [6]. Die
abgestorbenen Stammpartien wurden bei der Sanierung im Jahre 1965 entfernt.
Der Stamm besteht nur noch aus den äußeren Teilen des Splintholzes mit
Kambium, Bast und Rinde, die zum Teil nach innen eingerollt ist. Das Kernholz
ist nicht mehr vorhanden. Die früheren großen Äste sind nur noch in
Ansätzen zu erkennen. Weil sie überlang und kopflastig geworden waren,
brachen sie vor Jahrhunderten durch Sturm und Blitzschlag heraus. Von dem
immer morscher gewordenen tragenden Stamm brachen weitere Äste ab.

 Der Reststamm bildet eine Sekundärkrone, die von mehreren, teilweise auf
Steinplatten ruhenden Holzstangen gestützt wird, ohne die der Baum umstürzen
würde [7]. Die tief
angesetzte, einseitig ausladende Sekundärkrone besteht aus mehreren
verzweigten Ästen. Sie ist im Sommer gut belaubt und hat einen reichen
Blüten- und Fruchtansatz [8]. Der Baum war im Jahre
2005 elf Meter hoch und hatte einen Kronendurchmesser von acht Metern [9]. 1989 betrug der Umfang des Stammes, in einem
Meter Höhe gemessen, zwölf Meter [10]. Die
Eiche liegt mit diesen Maßen nach dem Deutschen Baumarchiv, dem der
Stammumfang in einem Meter Höhe als wichtigstes Auswahlkriterium dient, über
dem unteren Grenzwert der national bedeutsamen Bäume (NBB) [10]. Vollständig erhalten, hätte der Stamm einen
Umfang von etwa 14 Metern [9]. Damit handelt es
sich um die dickste Eiche in Deutschland. Nur die einstmals stärkste Eiche
der Welt, die Dagobertseiche im hessischen Dagobertshausen, deren letzte Reste
um 1900 verschwanden, hatte im Jahre 1840 mit 14,86 Metern, auf einem Meter
Höhe gemessen, einen größeren Umfang [11]. Der
Durchmesser des Stammes in Brusthöhe (BHD) wurde im Jahre 1892 mit etwa 4,5
[9] und der Umfang des Stammes in Mannshöhe im Jahre 1902 mit 12,5 Metern
angegeben [10]. Im Jahre 1927 betrug er 14 Meter [4].
Der Reststamm bildet eine Sekundärkrone, die von mehreren, teilweise auf
Steinplatten ruhenden Holzstangen gestützt wird, ohne die der Baum umstürzen
würde [7]. Die tief
angesetzte, einseitig ausladende Sekundärkrone besteht aus mehreren
verzweigten Ästen. Sie ist im Sommer gut belaubt und hat einen reichen
Blüten- und Fruchtansatz [8]. Der Baum war im Jahre
2005 elf Meter hoch und hatte einen Kronendurchmesser von acht Metern [9]. 1989 betrug der Umfang des Stammes, in einem
Meter Höhe gemessen, zwölf Meter [10]. Die
Eiche liegt mit diesen Maßen nach dem Deutschen Baumarchiv, dem der
Stammumfang in einem Meter Höhe als wichtigstes Auswahlkriterium dient, über
dem unteren Grenzwert der national bedeutsamen Bäume (NBB) [10]. Vollständig erhalten, hätte der Stamm einen
Umfang von etwa 14 Metern [9]. Damit handelt es
sich um die dickste Eiche in Deutschland. Nur die einstmals stärkste Eiche
der Welt, die Dagobertseiche im hessischen Dagobertshausen, deren letzte Reste
um 1900 verschwanden, hatte im Jahre 1840 mit 14,86 Metern, auf einem Meter
Höhe gemessen, einen größeren Umfang [11]. Der
Durchmesser des Stammes in Brusthöhe (BHD) wurde im Jahre 1892 mit etwa 4,5
[9] und der Umfang des Stammes in Mannshöhe im Jahre 1902 mit 12,5 Metern
angegeben [10]. Im Jahre 1927 betrug er 14 Meter [4].
Zur Altersangabe der
Eiche gibt es stark differenzierende Angaben. Da das älteste Holz aus dem
Zentrum des Stammes fehlt, ist weder eine Jahresringzählung [12] noch eine Radiokohlenstoffdatierung [13] möglich. Das Alter der Eiche kann deshalb nur
anhand des Stammumfangs und der geschichtlichen Überlieferungen grob
geschätzt werden.
Die Eiche ist den neuesten Erkenntnissen nach vermutlich zwischen 600 und 850
Jahre alt. Damit wäre sie die älteste Eiche in Deutschland [14]. Das Deutsche Baumarchiv schätzte das Alter der
Eiche im Jahr 2008 auf 600 bis 850 Jahre, wobei die 600 Jahre von Bernd
Ullrich stammen und die 850 Jahre vom Deutschen Baumarchiv [10]. Diese Angabe basiert auf einem jährlichen
Umfangszuwachs bei alten Eichen von etwa 1,8 Zentimetern [15],
der sich anhand langjähriger Untersuchungen von Stammumfängen und dem
rekonstruierten Stammumfang der Femeiche von 14 Metern ergab.
Jahresringzählungen bei bis zu 450-jährigen Eichen der Region ergaben
jährliche Umfangszuwächse von 1,5 bis 1,7 Zentimetern [16].
Anhand dieser Werte wäre die Eiche etwa 800 bis 900 Jahre alt.
Andere Altersangaben liegen zwischen 1000 [17][18],
1300 [9] und 1500 Jahren [19][20][21].
Diese Schätzungen basieren überwiegend auf der geschichtlichen
Überlieferung. Böckenhoff schrieb im Jahre 1966: „Da
man Freistühle an ausgezeichnete Stellen setzte, sie alsdann nicht mehr
verrückte, müßte die Eiche, als man den Stuhl aufstellte, wohl zur Zeit
Karls des Großen, schon ein mächtiger Baum gewesen sein. Demnach wäre sie
heute etwa 1500 Jahre alt.“ [21] Ein
Grund für das hohe Alter der Eiche könnte sein, dass sie als erste in der
Region ihre Blätter entfaltet. Der Eichenwickler, ein Laubschädling, konnte
ihr bisher nichts anhaben, da er sich erst nach dem Austrieb der übrigen
Eichen entwickelt [4].
|
|
|
|
|
Die 1500jährige Erler Femeiche |
|
Die offizielle Informationstafel
über das Naturdenkmal "Femeiche". |
Der alte Name Rabens- beziehungsweise Ravenseiche und der Name der Gegend Aßenkamp deuten auf eine Verbindung zur germanischen Mythologie hin. Der Rabe ist das Symbol des germanischen Toten- und Kriegsgottes Odin und die Asen waren ein germanisches Göttergeschlecht. Die Landschaftsarchitektin Anette Lenzing hat daraus in ihrem Buch Gerichtslinden und Thingplätze in Deutschland die Vermutung abgeleitet, die Femeiche sei möglicherweise bereits zu germanischer Zeit als Gerichtsstätte (Thing) benutzt worden [26]. Es ist allerdings nicht gesichert, ob es sich tatsächlich um die heutige Femeiche handelte oder ob an gleicher Stelle eine Vorgängereiche stand. Nach einer Sage saß der Gott Odin selbst als Richter unter der Eiche, seine beiden Raben, Hugin und Munin, hockten in den Zweigen des Baumes [5].
|
|
|
|
| Ein
Kunstwerk aus neuer Zeit: Vorne die acht Schöffenstühle, dahinter
der Richtertisch mit dem Richterstuhl. Auf den Oberseiten der
Schöfffenstühle sind bekannte alte Namen ehemaliger Schöffen
eingemeißelt. Foto: Michael Kleerbaum |
"Vrien
Stoel tum Assenkampe" steht auf dem mit Schwert und Galgenstrick Richtertisch eingemeißelt. Foto: Michael Kleerbaum |
|
|
| Schwert und
Galgen auf dem "Richtertisch" an der Femeiche. Foto: Lisa-Marie Kleerbaum, mit freundlicher Genehmigung |
Überliefert ist, dass 1441 der
Freigraf Bernt de Duiker unter der Eiche Gert von Diepenbrock und zwei
seiner Knechte wegen Schöffenmord verfemte und sie in Abwesenheit für
vogelfrei erklärte [28]. Der Bericht über die
Gerichtsverhandlung ist der älteste schriftliche Nachweis der Eiche. In
einem Schreiben mit der Nummer XXXVIII im Stadtarchiv von Bocholt aus dem
Jahre 1441 heißt es: „Bernd die Ducker, Freigraf zu Heiden verfehmt den
Gerd Deipenbroik und dessen Knechte, und fordert alle Freischöpfen des H.
R. Reichs auf, dieselben an den ersten Baum aufzuhängen, weil sie zwei
Freischöpfen ermordet hatten.“ [29] Dort ist
auch die Rede vom „Vrygenstole tor Ravenseick“ und dem „Vryenstoel ten
Hassenkampe by Erler“ [30].
|
|
| "Richtertisch"
und "Schöffenstühle" Foto: Lisa-Marie Kleerbaum, mit freundlicher Genehmigung |
Im Jahr 1442 wurden die
Befugnisse der Femegerichte durch den Reichstag stark eingeschränkt, so
dass sie an Bedeutung verloren. Eine weitere Gerichtsverhandlung ist von
1543 überliefert [31]. Unter der Eiche wurde
bis zum Jahre 1589 Femegericht abgehalten [32].
Im 16. Jahrhundert musste das Femegericht mit dem Erstarken der Landeshoheit
des Fürstbischofs von Münster einen Großteil seiner Zuständigkeiten
abgeben und wurde Ende des 18. Jahrhunderts aufgelöst [27].
 |
 |
|
|
Die 1500jährige
Erler Femeiche vor dem alten Pfarrhaus |
Die
Erler Femeiche im Frühling Foto: Helmut Kölking, mit frndl. Genehmigung |
„Um 1750 war die Höhlung noch unbedeutend; wir hören um diese Zeit, daß es dem kleinen Sohne des benachbarten Zellers Tellmann große Mühe kostete hineinzukriechen, um die Eier herauszuholen, die des Pastors Enten dort zu legen pflegten. Pastor de Weldige soll dann den Baum haben aushöhlen und einen Eingang zu demselben haben machen lassen.“
In der Dorfchronik von Erle wird über mehrere Begebenheiten in der hohlen Eiche in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts berichtet. Landrat Devens heftete am 5. Juli 1814 im Innern der Eiche dem damals 81-jährigen Pastor Lohede den Roten Adlerorden an [35]. Der Kronprinz von Preußen, der spätere König Friedrich Wilhelm IV., ließ am 26. September 1819 während eines Manövers in der Erler Heide 36 voll ausgerüstete Infanteristen in der Eiche aufstellen, so groß war die entstandene Höhlung [35]. Vorher nahmen der Kronprinz und seine Generäle von Haacke und von Thielemann in der Eiche an einem gedeckten Tische ihr Frühstück ein. Wenn der Bischof von Münster zur Firmung in Erle weilte, wurde die Eiche festlich geschmückt und darin ein Umtrunk eingenommen. Am 1. Juni 1832 wurde der Bischof Kaspar Maximilian Droste zu Vischering nach der Firmung unter Gesang zur festlich geschmückten Eiche geleitet und erfrischte sich dort mit einem Glase Wein [35]. Ein weiteres Mal wurde der Bischof Kaspar Maximilian Droste zu Vischering am 16. Juli 1842 feierlichst empfangen, nachdem er in der Gemeinde Raesfeld am Tage vorher 150 Kinder gefirmt hatte [35]. Auch soll der Bischof Johann Georg Müller am 11. Juli 1851 bei einer Firmung mit seinem Hofkaplan den Landdechanten von Droste-Senden und neun Geistliche an einem runden Tisch in der Eiche zwei Stunden lang bewirtet haben [35]. Damals fanden auch Festlichkeiten wie Hochzeiten und Firmungen in und unter der Eiche statt [36].
 |
|
Die 1500jährige
Erler Femeiche im Winter |
„Es besteht die Absicht, die auf Grund und Boden der Pastorat Erle stehende uralte Eiche, möglichst zu erhalten, welcher Zweck dadurch erreicht werden kann, wenn die Eiche bezw. die Rest derselben möglichst bald ausreichend gestützt, mit eisernen Riemen umgeben bezw. die Aeste mit Draht befestigt werden & der Baum selbst mit einem Gitter umgeben wird. Der Alterthumsverein wird evtl. die Arbeiten ausführen lassen und solche leiten, während die nicht unerheblichen Kosten theils vom Kreisausschuss hierselbst getragen werden sollen. Indem ich Euer Hochwürden hiervon ergebenst Mittheilung mache knüpfe ich die Bitte daran, auch Ihrerseits Sich für die Sache interessiren und zur Durchführung derselben beitragen zu wollen.“
Im Jahre 1892 erhielt die Eiche daraufhin mehrere Stützbalken, um ein Umfallen zu verhindern. Die Stammteile hielten zusätzlich zwei Eisenringe zusammen [5]. Die Arbeiten führte von Buerbaum, Gartenarchitekt in Düsseldorf, gemeinsam mit dem Forstmeister Joly aus [38]. Über die Stützbalken schreibt Albert Weskamp 1902: „[…] Seit dem Jahre 1892, wo die Stützbalken tiefer in die Erde eindrangen, so daß eine fast meterhohe Spalte auf der Neigungsseite fast ganz in der Erde verschwand, beträgt der Neigungswinkel nur noch 60 Grad.“ [39] Ob schon vor 1892 Stützbalken vorhanden waren, ist nicht bekannt. Im Jahr 1897 sangen der Überlieferung nach 40 Mitglieder des Forstvereins im Hohlraum der Eiche ein Lied [8]. 1927 brach der Wipfel, so dass sich die Höhe des Baumes reduzierte, die vorher 18 Meter betrug [4].
|
|
| Sitzgelegenheiten an
der Femeiche. Foto: Lisa-Marie Kleerbaum, mit freundlicher Genehmigung |
Bevor der Baumpfleger Michael Maurer 1965 die Eiche aufwendig sanierte, berichtete er im Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck über den Zustand des Baums:
"Diese Eiche steht in Erle, in der Weme, nahe der Bundesstraße 224 von Borken nach Dorsten; 14 Meter mißt ihr Umfang, die lichte Weite der Stammröhre beträgt rund 2,85 Meter. Noch immer wächst und grünt der Baum, trotz alldem was ihm in einem Jahrtausend widerfahren ist. Blitz, Stürme und die ‚menschliche Hand‘; nichts konnte ihn zerschmettern, zerstören. Er ist aber schwer angeschlagen, man könnte fast sagen, gebeugt vom Alter‘. Gut gemeinte, menschliche Hilfen haben ihn nahezu an den Rand des Ruins gebracht. […] Von den einstigen großen Ästen sind nur mehr die Ansätze zu erkennen. Was an Laubträgern vorhanden ist, ist Neuwuchs. […] Die Stammröhre – beidseitig offen – steht schief. Die Stützen tragen sie. Die Rinden-, Holzwände sind so dünn geworden, daß zu befürchten ist, sie können die wiederaufgebaute Krone nicht mehr tragen. Die holzzerstörenden Pilze sitzen wie eine Haut auf dem gesunden Holz, in das sie ihre Wurzelspitzen treiben, unter dem scheinbar harten, schon durchfressenen, sichtbaren Holz. Die abwehrkräftigen Stoffe im Saft – in den Blättern erzeugt – können nur mehr in sehr beschränkten Maß zu den Stammwänden gelangen. Die Ringe schnüren die Saftstrombahn ab, immer ‚schwächer‘ wird der Baum.“
Detailaufnahme
Foto: Walter Biermann, mit freundlicher GenehmigungX Detailaufnahme
Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung
Detailaufnahme
Foto: Walter Biermann, mit freundlicher GenehmigungX Detailaufnahme
Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung
Ziel der Sanierung war, dass der Jahreszuwachs außen den Holzabgang im Inneren des Stammes überstieg, so dass die Stammschalen nicht dünner wurden. Der letzte verbliebene Eisenring, der inzwischen eingewachsen war und den Saftfluss verhindert hatte, wurde entfernt. Um den Saftfluss im Bereich der ehemals tief eingewachsenen Eisenringe zu fördern, schnitten die Baumpfleger die Zellschicht der Rinde ein und entfernten im Stamm das gesamte morsche und pilzbefallene Holz, dexelten den Rest ab, glätteten es und behandelten es mit pilztötenden Mitteln. Es blieben drei Fragmente übrig, die sich in vier Meter Höhe vereinigen. Das dürre Holz im oberen Teil des Baumes wurde entfernt, die Schnittflächen überzog man mit Lackbalsam. Die Holzstützen aus dem Jahr 1892 wurden durch sechs neue ersetzt, um die Sekundärkrone zu schützen. Zusätzlich erhielt der Baum zur Verbindung der Stammteile Gewindestäbe mit Überrohren und das rindenlose Holz eine wasserabweisende Beschichtung. Der festgetretene Boden um die Eiche wurde bis in 40 Zentimeter Tiefe ausgehoben und durch neue Erde, Humus und Baumfutter, einen Spezialdünger mit Langzeitwirkung, ersetzt. Darüber kam eine Kiesschicht zur besseren Belüftung und Bewässerung. Bohrungen bis zum Schwemmkies in vier Meter Tiefe sollten der Bodenverdichtung entgegenwirken. Das Betreten des Wurzelbereiches wurde untersagt, um zu vermeiden, dass der Boden erneut verdichtet wird. Die Sanierungskosten, die der Landkreis Recklinghausen übernahm, beliefen sich auf rund 20.000 Deutsche Mark [20][40][41].
 |
 |
|
|
Femeiche und Pfarrhaus ca. 1930 Foto: Seibert (laut Notiz auf der Rückseite) Quelle: Archiv Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
X |
Die Femeiche um 1890 |
X
Ein zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Schutz angebrachter Zaun wurde während
der Sanierung 1965 entfernt. 1986 und 1987 wurde der Stamm erneut behandelt [32], wobei der Kies gegen wasserspeicherndes
Lavagranulat ausgetauscht wurde. Unsere Femeiche ist ein
beliebter Besuchermagnet. So beliebt, das man die Eiche im April 1994 wieder
einzäunen musste [2] um dieses unersetzliche
Naturdenkmal vor Souvenirjägern, Zerstörern und Brandschatzern zu schützen.
Selbst Angriffen mit Handbohrern sah sich der Baum ausgesetzt. Bei einem Sturm im Mai 2000 erlitt die
Eiche einige Schäden. Die Krone musste zurückgeschnitten werden; den Rest
tragen drei neue Stützen [42]. Zur Erinnerung an
die Femegerichte unter der Eiche wurde im Sommer 2006 außerhalb des Zaunes
eine Skulptur aus Granit aufgestellt, die einen Gerichtstisch mit einem
Henkerseil und einem Schwert darstellen soll [36].
2008 sollte eine erneute Pflege die Krone der Tragkraft des Stammes anpassen [43]. Im Jahre 2011 bekam die Eiche neue Holzstützen.
Am 30. Oktober 2021 wurde die Femeiche zum zwölften Nationalerbe-Baum
überhaupt und zum ersten Nationalerbebaum im Münsterland erklärt. [48]
Der Text dieses Artikels bis hierhin basiert auf dem Artikel Femeiche aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unportet (Kurzfassung (de)). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Besonders bedanken möchte ich mich bei Rainer Lippert, der den Artikel in der Wikipedia auf den heutigen Umfang ausgebaut und ihm damit zu der Auszeichnung "Excellenter Artikel" verholfen hat.