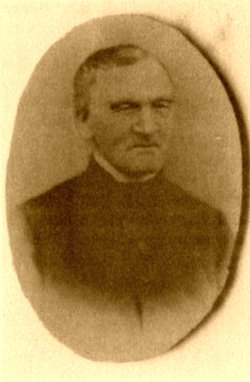|
| Der historische Dorfkern um die St. Silvesterkirche ist
immer noch sichtbar Foto: Reinhard G. Nießing, mit freundlicher Genehmigung |
WER WAR DER HL. ST. SILVESTER?
Die Wikipedia gibt Auskunft: "Silvester I. (†
31. Dezember 335 in Rom), dessen Namenstag am letzten Tag des
Kalenderjahres gefeiert wird, amtierte von 314 bis zu seinem Tod 335
als Bischof von Rom (Papst). Silvester folgte am 31. Januar 314
Miltiades als Papst. Sein Name wurde 813 in den Kirchenkalender
aufgenommen. Nach ihm wurde der später heiliggesprochene Marcus Papst.
 Nach einer frühmittelalterlichen Legende soll
Silvester den kranken römischen Kaiser Konstantin den Großen vom
Aussatz geheilt und getauft haben. So dokumentiert es die
Konstantinische Schenkung, eine gefälschte Urkunde, deren Entstehung
man im 6. oder 7. Jahrhundert vermutet. Verbreitet wurde die Legende in
der mittelalterlichen Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. Zum Dank
für die Heilung soll Silvester von Konstantin das sogenannte
Patrimonium Petri, das die Grundlage des späteren Kirchenstaates
bildete, als Geschenk erhalten haben. Die Behauptungen der Legende
halten einer Überprüfung nicht stand: Konstantin hatte bereits 313 im
Toleranzedikt von Mailand das Christentum offiziell erlaubt, Silvesters
Vorgänger Miltiades das Gelände des heutigen Lateranpalastes übergeben
lassen und beim Konzil von Nicaea 325, an dem Silvester persönlich
nicht teilnahm, sich aber von zwei Presbytern vertreten ließ, das erste
Glaubensbekenntnis festschreiben lassen, das Nicaenum. Silvester war
es, der über dem Petrusgrab in Rom, im Gräberfeld des Vatikanischen
Hügels, die erste Petruskirche erbauen ließ.
Nach einer frühmittelalterlichen Legende soll
Silvester den kranken römischen Kaiser Konstantin den Großen vom
Aussatz geheilt und getauft haben. So dokumentiert es die
Konstantinische Schenkung, eine gefälschte Urkunde, deren Entstehung
man im 6. oder 7. Jahrhundert vermutet. Verbreitet wurde die Legende in
der mittelalterlichen Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. Zum Dank
für die Heilung soll Silvester von Konstantin das sogenannte
Patrimonium Petri, das die Grundlage des späteren Kirchenstaates
bildete, als Geschenk erhalten haben. Die Behauptungen der Legende
halten einer Überprüfung nicht stand: Konstantin hatte bereits 313 im
Toleranzedikt von Mailand das Christentum offiziell erlaubt, Silvesters
Vorgänger Miltiades das Gelände des heutigen Lateranpalastes übergeben
lassen und beim Konzil von Nicaea 325, an dem Silvester persönlich
nicht teilnahm, sich aber von zwei Presbytern vertreten ließ, das erste
Glaubensbekenntnis festschreiben lassen, das Nicaenum. Silvester war
es, der über dem Petrusgrab in Rom, im Gräberfeld des Vatikanischen
Hügels, die erste Petruskirche erbauen ließ.
Silvester starb am 31. Dezember 335. Sein Leichnam wurde in der
Priscillakatakombe an der Via Salaria Nova in Rom beigesetzt. Er wird
als Heiliger verehrt und ist der erste heilige Papst, der nicht das
Martyrium erlitten hat. Sein Gedächtnis wird von der
griechisch-orthodoxen Kirche und der bulgarisch-orthodoxen Kirche am 2.
Januar, von der russisch-orthodoxen Kirche am 15. Januar und von der
römisch-katholischen an seinem Todestag, dem 31. Dezember, gefeiert.
Dieser Tag wird deshalb Silvester genannt. Sein Name bedeutet: der
Waldmann (lat., von silva ‚Wald‘). Silvester I. ist Patron der
Haustiere; für eine gute Futterernte, ein gutes neues Jahr."
DIE GESCHICHTE DER KIRCHE IN ERLE
Bis in die graue Vorzeit, als den hier wohnenden
Sachsen die christliche Botschaft mehr oder weniger freiwillig
vermittelt wurde, reichen die Anfänge der Geschichte
der Pfarrei St. Silvester zu Erle. Es wird davon ausgegangen, dass
bereits im 9. Jahrhundert Missionare von Borken aus in der Gegend um
Erle missionierten [1]. Einige Funde, die
in bei Grabungen den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts getätigt wurden
beweisen, dass die fränkisch-merowingischen Siedler im 5.-8.
Jahrhundert, die in der Gegend um Erle heimisch und bereits missioniert
waren [2]. Aber wann die erste Kapelle,
Kirche und der Pfarrhof entstand, oder wer die ersten Pfarrer waren
dass lässt sich heute nicht mehr ergründen, da es keinerlei Unterlagen
aus dieser Zeit mehr gibt. Höchstwahrscheinlich sind sie alle in dem
Jahrhundert der Glaubenswirren und des Wiedertäufertums verloren
gegangen. Es wird vermutet, dass bereits im 10. Jahrhundert an
der Stelle des aktuellen Kirchenbaus eine kleine Kirche aus Holz stand.
Diese Holzkirche soll um die Jahrtausendwende 999-1000 errichtet
worden sein. Das Dorf Erle gehörte bis zum 12. Jahrhundert zur Pfarrei
St. Martin in Raesfeld, wurde dann aber davon getrennt und zur
eigenständigen Pfarrei erhoben [1][11].

St. Silvester in der Silvesternacht 2017
Foto: Christina Kölking, mit freundlicher
Genehmigung.
Dazu schreibt Adolph Tibus in seinem Buch "Gründungsgeschichte der
Stifter, Pfarrkirchen, Klöster und Kapellen im Bereiche des alten
Bisthums Münster" von 1885 [3]:
In einem Lehnregister der Grafen von Solmisse zu Ottenstein aus dem 14. Jahrh. stehen angegeben: „in den Kerspele van Erler bat grote Hach V scep. rocgen tendemate, dat lüttike Hach IX scep. rocgen und elick 4 Hellinge, 1 goes, 1 hoen, 1 schaep wannet dar is). Auf der kleinen Glocke der Kirche von Erle, die 1851 geborsten und umgegossen ist, fand sich diese Inschrift: „Catharina heit ic, den doden betrov ic, Hagel und donner breck ic. MCCCCLXIX". Der Name Catharina kommt neben dem der h. Muttergottes und des Kirchenpatrons häufig auf Glocken vor. Die alte Kirche wurde im Jahre 1560 während der Stürme der Reformation eingeäschert, dann wieder aufgebaut und im J. 1631 nach der Ostseite hin erweitert. Gegenwärtig ist ein Kirchenneubau im Werke.
Patron der Kirche zu Erle ist der h. Papst Sylvester. Wie wir schon öfters wahrgenommen, haben die Filialkirchen vielfach ein dem Patrocinium der Mutterkirche verwandtes Patrocinium gewählt. Das trifft auch hier wieder zu. St. Sylvester steht nicht blos wie St. Remigius an der Spitze einer neuen Aera der Kirchengeschichte, sondern das kirchliche Officium stellt auch ausdrücklich den h. Remigius an Tugenden dem h. Sylvester gleich. Wir finden auch nirgends so viele Kirchen zusammen, welche der allgemeinen Regel zuwider Heilige als Patrone verehren, die nicht zu den Märtyrern zählen, als in der Umgebung von Borken, Hier hat Raesfeld den h. Martinus, Erle den h. Sylvester, Ramsdorf die h. Walburgis, Weseke den h. Liudger, Rhede die h. Gudula, Stadtlohn den h. Othgerus. Da läßt es sich nicht verkennen, daß Borken mit seinem Remigius-Patrocinium auf die Wahl der Patrocinien der Nachbarkirchen Einfluß ausgeübt hat.
Deryck van Wijk, dieser Pastor wird namentlich in einer alten Urkunde als Zeuge bei der Testamentsaufsetzung des Johann von Raesfeld am 23. November 1500 erwähnt. [6]
Aus den Aufzeichnungen von Pfarrer Michael Spanier ergibt sich u.a. folgende Reihe von Pastoren von 1533 an [4]:
Jakob Brabander, er war der letzte katholische Pfarrer von Erle vor den Glaubenswirren. Er starb 1533.
Johannes Bernadi (Hardenberrich oder Hadenberg). Halbkatholischer Pfarrer von 1533-1555. Zu dessen oder zu der Zeit seines unbekannten Nachfolgers scheint das damalige Kirchengebäude abgebrannt zu sein. So schrieb es Pfarrer H. Korte 1664 in einer Kirchenrechnung.
Unbekannter Vikarius aus Dorsten. Er ging 1559 angeblich aus religiösen Gründen von Erle weg.
Johann Bocholt, genannt Johann Buchholz. Pfarrer in Erle von 1559 bis 1566. Er ging dann ins Emsland.
Philippus Raßfelt. Pfarrer von 1566 bis vermutlich 1586. Er war ein verbitterter, schlimmer Calvinist. Mit der allgemeinen Billigung der verblendeten Gemeinde zerstörte er alle drei Altäre des damaligen Kirchenbaus, verbrannte alle Heiligenbilder, alle Statuen wurden aus der Kirche verbannt, die Wandgemälde überweißt, das Tabernakel geleert. Es wurden von einem Beauftragten des Bischofs aus Münster nur noch einige protestantische Gesangbücher und im Taufbrunnen nur Fliegen und Spinnenweben vorgefunden. Nach 20 Jahren wurde er vermutlich nach Bevergen geholt und später des Landes verwiesen.
Jakob Funke, Pfarrer von 1586 bis 1590. Von diesem wissen wir durch Michael Spanier nur, dass er aus Dorsten kam und nach 3-4 Jahren dorthin wieder zurückkehrte.
Conradus Storrich, Pfarrer von 1590-1622/'23. Heinrich Lammersmann berichtet über diesen: "Gerade dieser Pastor muß in der Gemeinde Erle viel Unheil angerichtet haben durch seine Unbeständigkeit und sein schlechtes Beispiel." Wahrscheinlich hat er wegen einem Erlass des Münsteraner Fürstbischofs Ferdinand die Gemeinde verlassen müssen und zog mit seiner Frau nach Schermbeck. Wegen seiner vielfältigen Verfehlungen soll er nach seinem Tode keine Ruhe gefunden haben und soll noch heute mit seiner Frau im Arme auf dem Wege zur Ludgeruskapelle "umgehen".
Michael Spanier, Pfarrer von 1622 bis 1659. Michael Spanier hat nach den ganzen Wirren und Glaubensirrungen die Erler wieder auf den katholischen Weg zurückgebracht und unter großen persönlichen Opfern und mit viel Engagement das damalige Kirchengebäude wieder auf Vordermann gebracht. Ausführlich berichtet Heinrich Lammersmann in seinem Aufsatz "Michael Spanier" über diesen Pfarrer.
Heinrich Korte, Pfarrer von 1659 bis 1678. Er schrieb 1664 auf, dass "die Kirche vor Hundert und etlichen Jahren durch eine Fewerß Brunst eingeäschert..."
Hermann Quickstert, Pfarrer von 1678 bis 1727. Er begann sofort ein Kopulationsregister zu führen, ab 1696 auch ein Taufregister. Vor allem Pfarrer Quickstert verdankt die Gemeinde St. Silvester die ersten regelmäßigen schriftlichen Aufzeichnungen, z.B. hat er auch detaillierte Aufzeichnungen über die Kirchengüter gemacht. Er gründete auch die ersten beiden Schulgebäude.
Joseph Cumann, Pfarrer von 1727 bis 1769. Pfarrer Cumann führte das Sterberegister ein und die Gemeinde durch den siebenjährigen Krieg und erhielt und verschönerte das damalige Gotteshaus trotz der mühseligen Umstände. Er ließ auch als erster Pfarrer die kirchlichen Ländereien vermessen und durch Grenzsteine sichern.
Joseph Anton de Weldige-Cremer, Pfarrer von 1770 bis 1814. Dieser Pfarrer führte Erle durch die schwierige Zeit der Säkularisation, der Besatzung durch die Franzosen, dem berüchtigten "Kosakenwinter" 1813-1814. Pfarrer de Weldige-Cremer hat auch die Erler Femeiche vom kranken Kernholz befreien lassen.
Franz Lohede, Pfarrer von 1814 bis 1843. Als erstes baute Pfarrer Lohede ein dringend benötigtes größeres Schulhaus und reparierte und verschönerte das von seinem Vorgänger durch die Umstände vernachlässigte Gotteshaus.
Anton Nonhoff, Pfarrer von 1843 bis 1891. Pfarrer Nonhoff hinterließ eingehende Aufzeichnungen in der Kirchenchronik. Pfarrer Nonhoff feierte in Erle sein silbernes, goldenes und diamantenes Pfarrjubiläum. Er war auch der Initiator der Pflanzung der Pius-Eiche [12] zu Ehren des Papstjubiläums Pius IX. In der Zeit von Pfarrer Nonhoff fällt auch der Abriss der kleinen Kirche und der Neubau des jetzigen Kirchengebäudes [13].
Peter Karthaus [7][8], Pfarrer von 1891-1927, zuvor Kaplan in Erle von 1887 bis 1891. Pfarrer Karthaus ist als u.a. wegen seiner unermüdlichen Bemühungen, das neue Gotteshaus würdig auszustatten und wegen seines selbstlosen, bescheidenden Einsatzes als Seelsorger in seiner Gemeinde in die Erler Kirchengeschichte eingegangen. Hervorzuheben ist, dass er 1923 bescheiden auf die Nennung seines Namens auf den neuen Kirchenglocken verzichtet hat und das er aus Rom eine Reliquie des hl. St. Silvester mit nach Erle brachte. Die Kaplanei an der Schermbecker Strasse wurde 1914 gebaut, ebenso der neue Friedhof 1926 eingeweiht. Ausführlich berichtet Heinrich Lammersmann in seinem Aufsatz "Landdechant Peter Karthaus" und "Das goldenen Priesterjubiläum des hochw. Dechant P. Karthaus" über diesen Pfarrer. Zu Ehre von Dechant Karthaus wurde in Erle eine Straße nach ihm benannt.
X


Pfarrer Anton Nonhoff
Foto: Gemeinde St.Silvester, mit freundlicher Genehmigung von Pastor BarlageDechant Peter Karthaus
Foto: Gemeinde St.Silvester, mit freundlicher Genehmigung von Pastor BarlagePfarrer Eberhard Grosfeld
Foto: Gemeinde St.Silvester, mit freundlicher Genehmigung von Pastor BarlageXEberhard Grosfeld, Pfarrer von 1928 bis 1948. Unter Pfarrer Grosfeld wurde die Kirche weiter ausgestattet und auch zum ersten Mal renoviert. 1930 wurde unter der Sakristei ein Keller und für die Kirche eine Warmluftheizung angelegt. In seine Zeit in Erle fallen auch die bittersten Momente der neueren Zeit. Pfarrer Grosfeld musste miterleben, wie die Nationalsozialisten den Unterricht von Geistlichen in den Schulen und die Fronleichnamsprozession sowie sämtliche kirchliche Fahnen verbieten und alle kirchlichen Vereine auflösen ließen. Auch musste die Kirchengemeinde am 22.01.1942 die beiden größten Glocken, die ja erst von Dechant Karthaus gestiftet worden sind, zur Einschmelzung abliefern. Und er musste mit ansehen, wie am Unglückstag Erles, dem 23. März 1945, die Kirche und Teile des Dorfes durch Fliegerangriffe zerstört wurden. Dieses dramatische Ereignis wird vom Augenzeuge Gerd Buskamp [9] in seinen "Erinnerungen unter der Femeiche" geschildert.
Theodor Vortmann, Pfarrer von 1949 bis 1966. In der Zeit von Pfarrer Vortmann begann der Wiederaufbau des Kirchenbaus und auch der restliche Teil seines Priestertums in Erle ist von den Aufbauarbeiten geprägt. Neben der Kirche entstand auch das Jugendheim im Pastorat, die neue kath. Volksschule (Silvesterschule) wurde eingeweiht und der neue Silvesterkindergarten wurde gebaut. Mit dem Neubau der Sakristei wurde begonnen.
Totenbriefchen für Pastor Theodor Vortmann
Quelle: Archiv Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung
Hermann Schürmann, Pfarrer von 1966 bis 1992. Unter Pastor Schürmann wurde die Pfarrbücherei 1967 im damaligen Pastorat, heutigem Pfarrheim, wieder eröffnet. Ebenfalls 1967 wurde der alte Friedhof an der Silvesterstraße geschlossen und das Gelände eingeebnet. Später befand sich darauf der Bolzplatz der Erler Jugend, dann wurde auf einem Teil des Geländes mit dem Jugendhaus überbaut. Im Juni 1970 wurde die Umgestaltung der Kirche nach Plänen von Prof. Manfred Ludes aus Dorsten begonnen, zu Ostern 1971 erhielt die Kirche ihre damals sehr moderne neue Chorausstattung durch den regional sehr bekannten Künstler und Bildhauer Hermann Kunkler. 1974 wurde die neue Friedhofskapelle eingeweiht, 1977 das neue Pastorat, ebenfalls von Prof. Manfred Ludes geplant. Das alte Pastorat wurde zum Pfarr- und Jugendheim umgewidmet.
Franz-Josef Barlage, Pfarrer von 1992 bis 2010. "Die Kirche sieht von außen aus wie ein Aussätziger". So, oder so ähnlich soll, laut dem Volksmund, der erste Eindruck des neuen Pfarrers von unserer Kirche gewesen sein, die auch in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts noch deutlich sichtbar die Spuren der Ausbesserungen der Kriegsschäden sowie den, in den Jahrzehnten seit dem Krieg, zu Erles Wahrzeichen gewordenen stumpfen Turm zeigte. Da aber noch genügend Erler die alte, neugotische Kirche kannten konnte Pastor Barlage in einer beispiellosen Aktion genügend Gelder sammeln um der Kirche innen und vor allem außen fast das alte Aussehen wiederzugeben. 1998 bekam Erle endlich wieder seinen schönen Kirchturm wieder. Das dieser höher ist als der Raesfelder haben die Erler mit Zufriedenheit zur Kenntnis genommen. Fotos vom Richtfest finden Sie hier. Pastor Barlage war der letzte eigenständige Pfarrer der Kirchengemeinde St. Silvester Erle..
X


Pfarrer Theodor Vortmann
Foto: Gemeinde St.Silvester, mit freundlicher Genehmigung von Pastor BarlagePastor Hermann Schürmann
Foto: Gemeinde St.Silvester, mit freundlicher Genehmigung von Pastor BarlagePastor Franz-Josef Barlage
Foto: Gaby Eggert,
mit freundlicher Genehmigung
X
DIE KATHOLISCHEN GOTTESHÄUSER IN ERLE
Geschichtlich gesichert, das heißt in Urkunden und Berichten erwähnt sind fünf Gotteshäuser [1], durch Augenzeugen bekannt sind allerdings nur vier. Natürlich wird es auch schon vorher diverse Kirchenbauten gegeben haben, aber leider hat die Zeit ihr Tuch des kollektiven Vergessens darüber gebreitet. Sehr detailliert hat als einer der letzte Augenzeugen der Heimatforscher Heinrich Lammersmann das sog. "Alte Kirchlein" in seinem Aufsatz "Das kleine Kirchlein 1550-1875" beschrieben [10].
| ???? bis 1550 |
Erwähnter,
aber unbekannter Kirchenbau |
| 1550 bis 1875 |
Das sog.
"kleine" Kirchlein |
| 1875 bis 1879 |
Die erste
Notkirche während des Neubaus |
| 1875 bis .... |
Das heutige
Kirchengebäude |
| 1945 bis 1950 |
Die zweite
Notkirche während des Wiederaufbaus |
DAS KLEINE KIRCHLEIN 1550 BIS 1875 [10]
Da Heinrich Lammersmann diese Kirche und ihre Geschichte in seinem Aufsatz "Das keine Kirchlein 1550-1875" bereits so ausgezeichnet detailliert beschrieben hat, verzichte ich hier an dieser Stelle auf eine erneute Beschreibung und wende mich dem heutigen Gotteshaus zu.
|
|
| Die
kleine Kirche von Erle 1550-1875 Zeichnung: Hauptlehrer Lammersmann |
DIE HEUTIGE KIRCHE 1875 BIS 1945 [1]
Bereits 1864 hat sich der damalige Pfarrer Nonhoff Gedanken darüber gemacht, wie er das Problem seiner ständig überfüllten Kirche lösen könnte. Bei den Gottesdiensten war es die Regel, das die Kirchentüren geöffnet blieben mussten, weil die Gläubigen nicht alle Platz in der Kirche fanden und teilweise auf dem Kirchplatz stehend dem Gottesdienst folgen mussten. Ein Neubau war die Lösung, doch die entbehrungsreiche damalige Zeit hat die Kassen der Kirchengemeinde geleert. Pfarrer Nonhoff wandte sich an den Münsteraner Architekten und Diözesanbaumeister Hilger Hertel der Ältere für die Anfertigung einer Skizze, eines Planes und eines Kostenvoranschlags, die Rechnung über 160 Thaler darüber mit Datum vom 20.10.1865 ist dem Kirchenarchiv noch vorhanden. Damit war aber noch keine Kirche finanziert. Also wandte sich Pfarrer Nonhoff an seinen Bischof und war bei der Beschreibung des Grundes, warum Erle eine neue Kirche bräuchte, sagen wir mal... sehr kreativ. Der eine Grund entsprach sogar der Wahrheit, das Gebäude war einfach zu klein. Aber dass die kleine Kirche auch noch baufällig war und der unmittelbare Einsturz drohe...das konnte Heinrich Lammersmann als Augenzeuge des Abbruchs wiederlegen. Zum Schluss mussten sogar die Fundamente untergraben werden um die Mauern zum Einsturz zu bringen und der Gebrauch von Pulver zur Sprengung wird erwähnt. Das lässt nicht auf eine Kirche schließen, die jeden Moment einzustürzen drohte.
|
|

|
|
| Kommunionkärtchen
24. April 1872 Scan: Archiv Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
Titelseite
Aufnahmebüchlein Herz-Jesu-Brunderschaft von 17. Januar 1898 Scan: Archiv Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
|
|
| Innenseiten
Aufnahmebüchlein Herz-Jesu-Brunderschaft von 17. Januar 1898 Scan: Archiv Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
Es hat wohl geholfen, jedenfalls gab der Bischof von Münster, Joh.
Georg, 1867 den Pfarrern seiner Diözese die Empfehlung, für
den Kirchenneubau ein Kollekte abzuhalten und deren Schäfchen
eine reichliche Beteiligung an der derselben zu empfehlen. Diese
Erlaubnis vorwegnehmend hatte Pfarrer Nonhoff bereits ein Jahr vorher
in Dorsten 330 Kollekten-Briefe drucken und bei der Theißingschen
Buchhandlung diverses Material zur schriftlichen Niederlegung der
Einnahmen gekauft.
Die Mühe, die sich Pfarrer Nonhoff damit machte trug auch schon schnell
Früchte, so übersandte der Dülmener Dechant Joh. Böckenhoff, ein
gebürtiger Erler, 97 Thr an die Silvestergemeinde. Auch aus anderen
westfälischen Gemeinden wird Kollektengeld eingetroffen sein, denn 1878
konnte Pastor Nonhoff eine Summe von Eingängen über 9000 Thr.
verzeichnen. Trotzdem reichte das Geld nicht aus, so dass Nonhoff auch
bei den Gläubigen im Regierungsbezirk Düsseldorf um Geld für den
Kirchenneubau bat.
„Freundliche Bitte!
Die kath. Pfarrgemeinde Erle, im Amte Altschermbeck Kreises Recklinghausen, war genöthigt, eine neue Kirche zu bauen, weil die alte wegen Baufälligkeit mit dem Einsturze drohte. Die Pfarreingesessenen an der 897, wovon ein bedeutender Theil in der angrenzenden Bürgermeisterei Schermbeck Kreises Rees Regierungsbezirks Düsseldorf wohnt, ist arm, muß sich von dem hier geringen Tagelohn und vom Ackerbau auf einem notorisch unfruchtbaren Sandboden nähren, und ist außerdem mit vielen Schulden belastet. In gerechter Würdigung unserer traurigen Lage hatte uns deshalb vor einigen Jahren das Königl. Ober-Präsidium zu Münster eine Hauscollekte in der Provinz Westfalen bewilligt, die unter Zurechnung einer Kirchencollecte die Summe von 90000 Th!r. eingebracht. Um den bereits angefangenen aber noch nicht vollendeten Neubau unserer Kirche vollenden zu können, ist uns von der Königl. Regierung zu Düsseldorf jetzt eine Hauskollekte in dem Regierungsbezirk Düsseldorf gewährt worden. Und so kommen wir denn, katholische Mitbürger, vertrauend auf eure Güte und Mildthätigkeit, zur euch und klopfen an eure Thüre, um euch flehentlich zu bitten, uns eine milde Gabe zu Vollendung des Baues unserer Kirche zu spenden. Wir wollen auch zu Gott, dem Vergelter alles Guten, für euch beten, damit er euch die irdische Gabe mit himmlischen Gütern reichlich belohnen wolle.
Erle, den 30. Juli 1878
Der Kirchenvorstand.
Nonhoff, Pfarrer."
Die finanzielle Lage war nach über 11 Jahren des fleißigen Sammelns wohl immer noch sehr prekär. Das lässt sich aus einer öffentlichen Versteigerung des Bauschutts des alten Kirchleins im September 1875 schließen. Doch irgendwie hat der Pfarrer es dann doch offensichtlich geschafft, die vom Baumeister Hertel veranschlagten 13.800 Thaler aufzutreiben und so konnte endlich mit dem Bau der neuen Kirche begonnen werden. Doch bevor das kleine Kirchlein abgerissen werden konnte musste natürlich für die Übergangszeit eine Notkirche her. Glücklicherweise verkaufte damals 1874 Graf Ferdinand von Merveldt eine Scheune, die Pastor Nonhoff von Erler Zimmerleuten abbrechen und wieder an ihrem neuen Platz aufstellen lies. Diese Unterfangen samt Vergrößerung der Scheune hat der Kirchengemeinde damals 391 Thr. gekostet.
Einige Nachrichten über den Neubau der Kirche zu Erle 1875 bis 1879 von Pfarrer Nonhoff aus der Kirchenchronik zu Erle, zusammengestellt von Lehrer Gramse im Heimatkalender 1954: [14]
 „Am 27. Juli 1875 wurde das letzte Hochamt in der alten
Kirche gehalten zur Danksagung für die vielen von Gott darin
empfangenen Gnaden und damit beim Abbruche der alten und beim Neubau
der Kirche alles glücklich vonstatten gehen möchte. Am 28. Juli gegen 6
Uhr morgens gingen wir in Prozession mit dem Kreuze voran aus der alten
Kirche zur Notkirche, welche auf der Pfarrweide (Wehme) mit dem Eingang
an der Püttstegge erbauet war. Dort angekommen ging ich mit Kaplan
Segbers und Küster hinein und nahm die Benediction derselben vor.
Danach wurde das Sanctissimum aus der alten Kirche unter dem Geläute
der Glocken feierlich abgeholt und mit dem Ciborium in die Notkirche
gebracht und wurde das erste Hochamt in der Kirche gehalten. Am 10.
August begann der Maurermeister Bernhard Koch aus Dorsten mit seinen
Arbeitern mit dem Abbruch der alten Kirche. Er wurde nach 7 bis 8
Wochen damit fertig. Mit den Grundmauern des Turmes an der Nordseite
ist am 8. Oktober der erste Anfang zum Neubau gemacht, nachdem zuvor morgens eine Messe gelesen und Gottes Hilfe beim Kirchenbau erfleht
wurde. Auf Wunsch des Maurermeisters wurde vom Pastor, Kaplan Segbers,
Johann Brandt, vom Rendanten Johann Böckenhoff und vom Vorsteller Franz
Koch in verschiedenen Ecken ein Grundstein gelegt. Darauf begann die
weitere Arbeit. Die Maurerarbeit mußte zu zwei Malen auf längere Zeit
sistiert werden, weil es an Ziegelsteinen mangelte.
„Am 27. Juli 1875 wurde das letzte Hochamt in der alten
Kirche gehalten zur Danksagung für die vielen von Gott darin
empfangenen Gnaden und damit beim Abbruche der alten und beim Neubau
der Kirche alles glücklich vonstatten gehen möchte. Am 28. Juli gegen 6
Uhr morgens gingen wir in Prozession mit dem Kreuze voran aus der alten
Kirche zur Notkirche, welche auf der Pfarrweide (Wehme) mit dem Eingang
an der Püttstegge erbauet war. Dort angekommen ging ich mit Kaplan
Segbers und Küster hinein und nahm die Benediction derselben vor.
Danach wurde das Sanctissimum aus der alten Kirche unter dem Geläute
der Glocken feierlich abgeholt und mit dem Ciborium in die Notkirche
gebracht und wurde das erste Hochamt in der Kirche gehalten. Am 10.
August begann der Maurermeister Bernhard Koch aus Dorsten mit seinen
Arbeitern mit dem Abbruch der alten Kirche. Er wurde nach 7 bis 8
Wochen damit fertig. Mit den Grundmauern des Turmes an der Nordseite
ist am 8. Oktober der erste Anfang zum Neubau gemacht, nachdem zuvor morgens eine Messe gelesen und Gottes Hilfe beim Kirchenbau erfleht
wurde. Auf Wunsch des Maurermeisters wurde vom Pastor, Kaplan Segbers,
Johann Brandt, vom Rendanten Johann Böckenhoff und vom Vorsteller Franz
Koch in verschiedenen Ecken ein Grundstein gelegt. Darauf begann die
weitere Arbeit. Die Maurerarbeit mußte zu zwei Malen auf längere Zeit
sistiert werden, weil es an Ziegelsteinen mangelte.Anfang August 1877 war die Mauer der Kirche und des Chores bis zur Höhe des Dachstuhles fertig, auch im Innern die steinernen Pfeiler mit Überbrückung. Die Ziegelsteine zum Bau unserer Kirche sind, mit Ausnahme der Formsteine, auf der Pastoratsweide von hiesigen Arbeitern (Heinrich Klaus, Eberhard Demmer, Johann Wewers und Hermann Gülker) unter Leitung meines Kaplans Segbers gebrannt worden.
Das war für unseren Bau von ungemein großem Nutzen, nicht allein weil wir die Ziegelsteine ganz in der Nähe der Baustelle hatten, sondern weil wir die Ziegel so billig hatten; die 1000 Stück zu ungefähr 5 Taler (15Mark). Nun kam wieder zu unserem größten Leidwesen ein Stillstand von 10 bis 11 Wochen, weil der Zimmermeister J. Terwey aus Raesfeld seine Arbeit noch nicht fertig hatte, um das Kirchendach aufführen zu können.
 Erst am 14. Oktober 1877 hat
er mit der Aufstellung des Dachstuhles begonnen. Mit öfterer, bald
längerer Unterbrechung wurde fortgebaut, bis endlich im Oktober 1879
Kirche und Sakristei im Rohen fertiggestellt und vom
Schieferdeckermeister Bernh. Knoop zu Raesfeld unter Dach gebracht war.
Der Turm war aufgeführt bis einige Fuß über die Dachfirst der Kirche.
Nun wurde im November 1879 im Innern der Fußboden der Kirche und des
Chores planiert, mit Ziegelsteinen provisorisch belebt, die Sakristei
beflurt, die Fenster vorläufig mit weißem Glase (Bernhard Mütter und
seine Gehilfen) verglaset, die beiden Türen an der Kirche nach Nord und
Süd und an der Öffnung von der Kirche zum Turme vermauert. Alles dies
geschah mit einer noch nie dagewesenen Tätigkeit und Ausdauer, um noch
im Dezember 1879 den Gottesdienst aus der Notkirche in die neue
verlegen zu können, wonach alle so sehnlichst verlangten. Nach 4 Jahren
und 3 Monaten, am 3. Dezember 1879, las ich ganz frühzeitig die hl.
Messe in der Notkirche, und bald darauf wurde der Altar abgetragen und
in der neuen Kirche wieder aufgestellt. Abends war lange anhaltendes
feierliches Geläute, Ehrenbögen wurden errichtet, die Häuser beflaggt,
kurz, alles mögliche getan zur Verherrlichung des Freudenfestes. Da
wegen des Kulturkampfes unser hochw. Herr Bischof Johann Bernard außer
seiner Diözese in der Verbannung sich befand, so konnte unsere Kirche
nicht eingeweiht werden. Der Herr Landdechant Bröring aus Dorsten hat
nach erhaltener bischöflicher Vollmacht die Benediction vorgenommen. Es
war aber am Benedictionsfeste, dem 4. Dezember 1879, so grimmig kalt
und ein heftiger Ostwind schnitt so empfindlich, daß es fast bei der
Prozession und bei der Vornahme der Zeremonien außer der Kirche nicht
zum Aushalten war. Es sind auch nur wenige der eingeladenen Herrn
Geistlichen und sonstige Herren herübergekommen zur Beiwohnung des
Festes. Das Mittagessen war in der Pastorat und waren zugegen:
Erst am 14. Oktober 1877 hat
er mit der Aufstellung des Dachstuhles begonnen. Mit öfterer, bald
längerer Unterbrechung wurde fortgebaut, bis endlich im Oktober 1879
Kirche und Sakristei im Rohen fertiggestellt und vom
Schieferdeckermeister Bernh. Knoop zu Raesfeld unter Dach gebracht war.
Der Turm war aufgeführt bis einige Fuß über die Dachfirst der Kirche.
Nun wurde im November 1879 im Innern der Fußboden der Kirche und des
Chores planiert, mit Ziegelsteinen provisorisch belebt, die Sakristei
beflurt, die Fenster vorläufig mit weißem Glase (Bernhard Mütter und
seine Gehilfen) verglaset, die beiden Türen an der Kirche nach Nord und
Süd und an der Öffnung von der Kirche zum Turme vermauert. Alles dies
geschah mit einer noch nie dagewesenen Tätigkeit und Ausdauer, um noch
im Dezember 1879 den Gottesdienst aus der Notkirche in die neue
verlegen zu können, wonach alle so sehnlichst verlangten. Nach 4 Jahren
und 3 Monaten, am 3. Dezember 1879, las ich ganz frühzeitig die hl.
Messe in der Notkirche, und bald darauf wurde der Altar abgetragen und
in der neuen Kirche wieder aufgestellt. Abends war lange anhaltendes
feierliches Geläute, Ehrenbögen wurden errichtet, die Häuser beflaggt,
kurz, alles mögliche getan zur Verherrlichung des Freudenfestes. Da
wegen des Kulturkampfes unser hochw. Herr Bischof Johann Bernard außer
seiner Diözese in der Verbannung sich befand, so konnte unsere Kirche
nicht eingeweiht werden. Der Herr Landdechant Bröring aus Dorsten hat
nach erhaltener bischöflicher Vollmacht die Benediction vorgenommen. Es
war aber am Benedictionsfeste, dem 4. Dezember 1879, so grimmig kalt
und ein heftiger Ostwind schnitt so empfindlich, daß es fast bei der
Prozession und bei der Vornahme der Zeremonien außer der Kirche nicht
zum Aushalten war. Es sind auch nur wenige der eingeladenen Herrn
Geistlichen und sonstige Herren herübergekommen zur Beiwohnung des
Festes. Das Mittagessen war in der Pastorat und waren zugegen:Röhring, Landdechant; Pastor Eilers, Altschermbeck; Pastor Verspohl, Wulfen; Pastor Besseling, Holthausen; Dechant Böckenhoff, Dülmen; Pastor Riswik, Marienthai; Kaplan Segbers und Pfarrer Nonhoff und Baumeister Hertel zu Münster.
Die Möbel aus der Notkirche, die Kanzel, Bänke, Kommunionbank, Taufstein etc. wurden an den beiden folgenden Werktagen wieder in die neue Kirche gebracht. Die Notkirche wurde zum Abbruch für 230 Taler verkauft. Die Kirchensitze, welche in der Notkirche verpachtet waren, sind auch in der neuen Kirche zum Besten des Neubaues wieder verpachtet worden und bringen jährlich ein nettes Sümmchen von 250 Talern ein.
Der Fortbau des Turmes ist gegen Ende April 1880 wieder begonnen worden, und man hofft, mit Ende September damit fertig zu werden. Maurermeister Koch hatte aber schon in der zweiten Woche des Septembers den Turm so weit aufgeführt, daß die 1. Balkenlage zum Dachstuhle der Turmspitze begonnen wurde. In der letzten Woche des Septembers 1880 begann Terwey mit der Aufstellung des Turmdachstuhles, nachdem zuvor eine hl. Messe gelesen wurde, daß Gott bei dieser so schwierigen und gefährlichen Arbeit vor Unglück bewahren wolle. Nach ungefähr 14 Tagen war das Werk glücklich zustande gebracht und am 16. Oktober, Tages vor dem Kirchweihfest, wurde von Bernh. Knoop das große eiserne Kreuz mit seinem vergoldeten Hahn auf dem schlanken Turm befestigt. Gott sei Dank, daß alles ohne das geringste Unglück so gut zustande gekommen ist! Die Bedachung des Turmes ist aber erst im April 1881 ganz vollendet worden."
Zu diesem Bericht aus der Chronik habe ich von alten Erler Bürgern, deren frühe Kindheit noch in die Zeit des Kirchenneubaues fiel, und aus anderer mündlicher Überlieferung interessante Einzelheiten in Erfahrung bringen können.
Die von Pfarrer Nonhoff in seinem Bericht erwähnte „Püttstegge", an der die Notkirche stand, ist ein alter Fußpfad gewesen, der von Heßling-Rohane zum Dorfpütt führte. An seiner Stelle ist dann später das letzte Stück der Schermbecker Straße gebaut worden. Von der Püttstegge führte eine Allee schwerer Eichen zur Wehme. Hier wurde ein provisorischer Glockenstuhl neben der Notkirche errichtet. Während der Bauzeit wurden dann die Eichen gefällt und ihr Holz zur Aufführung des neuen Glockenstuhles verwendet.
Der Feldbrand der Ziegelsteine wurde auf der Wehme, einem kircheneigenen Wiesengrundstück, vorgenommen. Da der Dorfkern auf einem Sand-Lehm- Flachhügel erbaut ist, hatte man das Material für die Steine gleich zur Hand. Im südlichen Teil der Wehme wurde aus einer damals angelegten Grube der Lehm für den Feldbrand entnommen. Noch heute ist nördlich der Marienthaler Straße bei dem Haus des Schneidermeisters Schwane eine erhebliche Bodenvertiefung erkennbar. Den vier im Bericht erwähnten Helfern unter der Leitung von Kaplan Segbers standen Fachkräfte aus dem „Ziegelbäck erländchen" Lippe zur Seite. Der Vertrag mit dem Steinbrenner befindet sich im Pfarrarchiv. [...]
 Es waren
Saisonziegelarbeiter, wie sie damals im Münsterland allenthalben
anzutreffen waren. Die Ziegelbäcker waren mit dem Formen der Ziegel
beschäftigt. An Schlagtischen, ähnlich wie sie heute noch die Siedler
beim Eigenheimbau zur Herstellung von
Schlackensteinen benutzen, wurden die Lehmziegel geformt und dann zum
Trocknen gestapelt. Als Wetterschutz diente eine Strohabdeckung. Zum
Brennen wurden die Ziegel zu 4 m breiten, nach oben schmaler werdenden
Reihen zusammengesetzt. Zwischen den Ziegeln blieb ein 1-2 cm breiter
Raum frei. Am Boden der Reihen wurden einige Feuergassen freigelassen.
Feuchter Lehm dichtete das Ganze nach außen ab. Nun konnte der Brand
beginnen. Als Heizmaterial verwendete man Holz. Der Brand dauerte 10-14
Tage, also erheblich länger als heute im Ziegelofen. Dieses an sich
umständliche und von Witterungseinflüssen abhängige Feldbrandverfahren
hat dann wohl auch die Bauzeit der Kirche erheblich verlängert.
Mehrmals auch geriet die Kirchengemeinde in Geldschwierigkeiten während
des Baues, so daß auch hierdurch Verzögerungen eintraten. Außer den
erheblichen geldlichen Opfern der Gemeinde und zahlreichen Geldspenden
einzelner Wohltäter wurde zur Finanzierung des Neubaues mit Genehmigung
der (damals) Königlichen Oberpräsidien zu Münster und Düsseldorf in den
beiden Regierungsbezirken eine Hauskollekte abgehalten. Diese brachte
allein im Regierungsbezirk Münster 9000 Taler (27000 Mark). Trotzdem
aber blieb nach der Beendigung des Baues noch eine erhebliche
Schuldsumme zurück, die erst im Laufe der späteren Jahre abgetragen
wurde.
Es waren
Saisonziegelarbeiter, wie sie damals im Münsterland allenthalben
anzutreffen waren. Die Ziegelbäcker waren mit dem Formen der Ziegel
beschäftigt. An Schlagtischen, ähnlich wie sie heute noch die Siedler
beim Eigenheimbau zur Herstellung von
Schlackensteinen benutzen, wurden die Lehmziegel geformt und dann zum
Trocknen gestapelt. Als Wetterschutz diente eine Strohabdeckung. Zum
Brennen wurden die Ziegel zu 4 m breiten, nach oben schmaler werdenden
Reihen zusammengesetzt. Zwischen den Ziegeln blieb ein 1-2 cm breiter
Raum frei. Am Boden der Reihen wurden einige Feuergassen freigelassen.
Feuchter Lehm dichtete das Ganze nach außen ab. Nun konnte der Brand
beginnen. Als Heizmaterial verwendete man Holz. Der Brand dauerte 10-14
Tage, also erheblich länger als heute im Ziegelofen. Dieses an sich
umständliche und von Witterungseinflüssen abhängige Feldbrandverfahren
hat dann wohl auch die Bauzeit der Kirche erheblich verlängert.
Mehrmals auch geriet die Kirchengemeinde in Geldschwierigkeiten während
des Baues, so daß auch hierdurch Verzögerungen eintraten. Außer den
erheblichen geldlichen Opfern der Gemeinde und zahlreichen Geldspenden
einzelner Wohltäter wurde zur Finanzierung des Neubaues mit Genehmigung
der (damals) Königlichen Oberpräsidien zu Münster und Düsseldorf in den
beiden Regierungsbezirken eine Hauskollekte abgehalten. Diese brachte
allein im Regierungsbezirk Münster 9000 Taler (27000 Mark). Trotzdem
aber blieb nach der Beendigung des Baues noch eine erhebliche
Schuldsumme zurück, die erst im Laufe der späteren Jahre abgetragen
wurde.Nun hatten die Erle ihre neue, geräumige und schöne Kirche. Leider war man wegen der nicht gerade gesicherten Finanzierung und der Tatsache, das nach dem Bau der Kirche immer noch immense Schulden auf der Gemeinde lasteten, in der Lage die Kirche von innen auch würdig und genauso schön auszustatten. Pfarrer Nonhoff schrieb dazu in seinen Aufzeichnungen:
„Als wir am 3. Dezember 1879 in unsere neu erbaute Kirche einzogen und das erste Hochamt am folgenden Tage nach der Einsegnung derselben darin gehalten wurde, sah es im Innern noch recht armselig, leer und notdürftig aus. Aber was machen? An neue Möbel und Verschönerung im Innern des Gotteshauses war noch nicht zu denken, da das Geld fehlte und die Bauschulden noch nicht gedeckt waren. Wir mußten bei der inneren Verschönerung Geduld haben und auf müde und freigebige Herzen vertrauen. Diese haben wir auch mit der Zeit recht viele gefunden.
1. Der Herr Pastor H. Schmilz in Heek, mein erster Kaplan in Erle, hat das bunte Fenster im Seitenschiffe nach Süden, Tapetenmuster, das erste, geschenkt.
2. Der Uhrmacher W. Nonhoff in Münster, mein Vetter, und Mina Nonhoff, Haushälterin bei mir, haben das gemalte Chorfenster, Darstellung die Geburt Christi, geschenkt. Diese Glasfenster sind die ersten und vom Glasmaler Viktor von der Forst gemacht und vom 6. - 9. Febr. 1880 eingesetzt. Ihm sind auch die übrigen Glasfenster übertragen. Hier bemerke ich, daß im Chore die gemalten Glasfenster den freudenreichen Rosenkranz bildlich darstellen werden.
3. Den Beichtstuhl an der Nordseite mit dem gepolsterten Sitzkasten hat die Pfarrgemeinde bei der Feier meines 50 jährigen Priester-Jubiläums am 16.12.1880 geschenkt.
4. Der eiserne Kronleuchter ist von dem Schmiedemeister in Münster gemacht und polychromiert. Die Zeichnung ist von Hertel. Der Kronleuchter ist ebenfalls ein Geschenk von der Pfarrgemeinde.
5. Von Franz Krampe gt. Nienhaus in der Westrick sind die zwei bunteil Glasfenster im Langschiffe nach Süden.
6. Das kleinere über der Kirchentüre ist von der Wwe. Hoppe in Üfte Kirchspiel Altschermbeck.
7. Vom Herrn Stadtdechanten Johann Böckenhoff zu Dülmen, gebürtig aus Erle, sind geschenkt die beiden ersten bunten Glasfenster im Langschiffe nach Norden.
8. Das kleinere über der Kirchentüre nach Norden ist von meiner früheren jetzt verstorbenen Dienstmagd Fina Klaus.
9. Das darauf folgende Glasfenster nach Norden ist gestiftet von einer Dienstmagd Mina Rademacher in Raesfeld, gebürtig aus Erle.
10. Nach Süden im Langschiffe das vierte große Glasfenster ist aus Beiträgen an Geld in Erle zusammengebracht worden.
Der alte Kirchturm im Schnee
Foto: Holger Steffe, Dorstener Zeitung, mit freundlicher Genehmigung.
Quelle: Archiv Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung
Als die Pfarrkinder sahen, wie das gewöhnliche Glas aus dem einen nach dem anderen Fenster herausgenommen und neu mit Tapetenmustern wieder eingesetzt wurde, freuten sie sich nicht wenig; es kam immer mehr Lust, auch etwas zur Verschönerung im Innern der Kirche zu geben, und die Bitte und Aufmunterung dazu fand Eingang und geneigte Herzen.
11. Den zweiten neuen Beichtstuhl nach Süden, vom Schreinermeister H. Heidermann zu Erle gemacht, hat der Zeller H. Schneemann in Westrick geschenkt.
12. Der Muttergottes-Altar in dem Seitenschiffe nach Norden ist ein Geschenk von dem Ziegelbrenner Xaver Menting in Overbeck Erle.
13. Der schöne Kreuzweg nach Zeichnung des Prof. Klein in Münster ist ein Geschenk von dem Brennereibesitzer Gerhard Böckenhoff in der Östrick.
14. Die Kommunionbank in Stein nach Zeichnung des Arch. Hertel in Münster ist ein schönes Geschenk des Kornhändlers H. Rossmann in Lembeck, Schwiegersohn des zuvor genannten Gerhard Böckenhoff.
15. Die beiden gemalten Fenster auch dem Chore, das zweite und dritte Gesetz aus dem freudenreichen Rosenkränze, sind ein herrliches Geschenk, und zwar das dritte Gesetz von Hermann Brömmel, Besitzer der Kolonats Schäper auf dem Wall, das zweite Gesetz von dem Zeller Joh. Pontsmann in Östrick.
16. Von dem seligen Gastwirt Joh. Böckenhoff und dessen Erben, die Geschwister Joseph und Elisabeth im Dorfe Erle, wird unsere Kirche eine neue schöne Kanzel noch bald zum Geschenk erhalten.
17. Der Wwr. Anton Nienhaus genannt Kiffmann und sein Schwiegersohn Heinrich Schwane genannt Kiffmann, schenken den zweiten Seitenaltar nach Süden, die Zeichnung dazu ist von Hertel gemacht und schon dem Schreinermeister Heinrich Heidermann hier in Arbeit gegeben.
18. Auch darf ich hier nicht vergessen den unverehelichten Schulte in Holland, aber gebürtig aus Erle, der seit mehreren Jahren alljährlich nach Erle kam, mich dann auch besuchte, und jedesmal für meine Kirche etwas mitbrachte, bald Geld, dann ein Altartuch oder Kommuniontuch, und vor drei Jahren brachte er mir von Holland gar eine wertvolle silberne Monstranz. Dank diesem guten Schenkgeber! Jetzt ist er seit langer Zeit nicht mehr hier gewesen - ob er vielleicht krank ist, habe ich nicht erfahren können.
Die Aufzeichnungen hierzu schließen mit einer Aufzählung weiterer Geldgeschenke.
Eine andere Quelle zum Thema "Ausstattung der neuen Kirche" liefert das Buch "Geschichte des Dorfes Erle und seiner Eiche", das Professor Dr. Weskamp Anfang des 20. Jahrhunderts veröffentlicht hat. Er schreibt dazu folgendes [15]:
„Am 19. Oktober 1887 wurde die Kirche durch den Weihbischof Kramer konsekriert. Die Mittel für die Ausstattung der neuen Kirche wurden durch fromme Schenkungen aufgebracht. Der Hauptaltar kostete 2400 Mark. Die Chorfenster, welche die Rosenkranzkönigin und die Geheimnisse des freudenreichen Rosenkranzes darstellen, wurden 1890-91 eingesetzt. Der Herz-Jesu Altar wurde 1888 nach einer Zeichnung des Architekten Hertel von Heidermann in Erle angefertigt; die Statuen auf demselben sind vom Bildhauer Schmiemann zu Münster. Der Aufsatz auf dem Muttergottesaltare und die Kanzel gingen hervor aus der Werkstatt von Röttger zu Velen. Der Taufbrunnen und das Muttergottesbild wurden von Hertel geliefert, das Bild der Mutter Anna, der hl. Agnes und die Prozessionsstation mit dem Bilde der schmerzhaften Mutter vom Bildhauer Bolle. Am 8. Dezember 1894 wurde bei Gelegenheit der Mission das Bild von der immerwährenden Hilfe aufgestellt. Für Instandsetzung der Paramente sorgte auch jetzt wieder an erster Stelle die gräfliche Familie von Merveldt. Für die Rosenkranzbruderschaft wurde 1896 eine Fahne geschenkt (Preis 300 Mark). 1898 eine St. Anna Fahne (Preis 425 Mark) für den Mütterverein; 1889 wurde die blaue, 1897 die rote Sodalenfahne angeschafft (Preis 450 und 285 Mark). Das 1892 aus der Nachlassenschaft von Frau Heßling geborene Stegerhoff angeschaffte Prozessionskreuz kostete 550 Mark. Von der Beschaffung der neuen Orgel im Jahre 1890 war schon oben die Rede. 1896 wurde die Kirche durch Schräder aus Münster bemalt; die Unkosten betrugen 4000 Mark."
|
|
| Foto:
Gemeinde St.Silvester, mit freundlicher Genehmigung von Pastor Barlage |
|
|
| 22.01.1942:
Zwangsabgabe der alten Glocken: Abseilung aus dem Turm Foto: "Querbeet", Heimatverein Erle e.V. |
|
|
| 22.01.1942: Zwangsabgabe der alten Glocken Foto: "Querbeet", Heimatverein Erle e.V. |
Wie allen Erlern bekannt sein dürfte, ist das Dorf während des 2. Weltkrieges zunächst weitgehend von Schäden an Leib und Sachen verschont geblieben. Kurz vor Ende des Krieges, am 23. März, änderte sich das aber grundlegend. In Vorbereitung auf die "Operation Varsity" (Die Alliierten haben in Wesel durch Luftlandetruppen einen Brückenkopf hergestellt, den Rhein überquert und sind dann Richtung Ostsee vorgestoßen, mehr Infos dazu hier), die die Alliierten auch durch Erle geführt hat wurde gezielte schwere Bomben- und Tieffliegerangriffe heimgesucht, die dem militärischen Beobachtungs- und Funkposten auf dem Kirchturm galten. Spreng- und Brandbomben zerstörten die meisten Häuser im Dorfkern rund um den Kirchturm, der dann später, in Brand geschossen, zusammenbrach und die Kirche zum größten Teil zerstörte.
Pastor Grosfeld erinnert sich daran in der Pfarrchronik [1]:
"Der 23. März war wohl der größte Unglückstag für Erle. An diesem Tage des Morgens gegen l0.00 Uhr erfolgte ein furchtbarer Fliegerangriff auf Erle, wohl dadurch hervorgerufen, daß unsere Soldaten, die hier einquartiert waren, ununterbrochen mit Maschinengewehren auf die feindlichen Flugzeuge schossen. Durch diesen Fliegerangriff wurde der Ort zum großen Teil und die Kirche fast ganz zerstört. Als ich nach dem Angriff aus meinem Luftschutzkeller kam, sah ich zu meinem Schrecken , daß der Dachstuhl des Kirchenschiffes fortgerissen war, glaubte aber zuerst, daß die Kirche selbst weiter keinen Schaden gelitten hätte. Ich konnte noch nicht sofort hingehen, weil ich dringend zum Hauptlehrer Sagemüller gerufen wurde, der tötlich getroffen an seiner Wohnung lag, und ebenso zu Regina Henneböhl, die sterbend auf der Chaussee lag. Nachdem ich beide versehen hatte, begab ich mich sofort zur Kirche, und da sah ich zu meinem tiefsten Entsetzen, den Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Die Bomben hatten das Gewölbe zum Einsturz gebracht, alles unter sich begrabend und verwüstend. Ein Menschenleben war Gott Dank nicht zu beklagen. Mein erster Gedanke war „das Sakrament", das ich aus dem noch heilgebliebenen Hochaltar nahm und zur Pastorrat brachte. Dann begab ich mich an die Rettung der noch heilgebliebenen Sachen, zuerst mit meiner Haushälterin Lina Postmeier allein - die Leute waren zum Teil in die Bauerschaft geflohen, zum Teil hielt sie noch die Furcht in den Luftschutzkellern. Doch bald kamen noch andere, und so konnte bis zum Abend alles, was heilgeblieben war, aus der Kirche gerettet werden: die kirchlichen Gefäße und Gewänder, die heiligen Figuren, die glücklicherweise unbeschädigt geblieben waren, und den Muttergottesaltar. Zu gleicher Zeit (bei dem Angriff waren auch Brandbomben gefallen) hatte aber auch der Turm Feuer gefangen, und da an eine Rettung nicht gedacht werden konnte, brannte er vollständig aus. Die Glocke, die Orgel und die beiden Beichtstühle fielen dem Feuer zum Opfer.
Mit Tränen in den Augen sahen wir diese unsere schöne Pfarrkirche in Trümmer sinken - ein harter Schlag für die Gemeinde, aber wir haben uns unter den Willen Gottes gebeugt und mit Job gesprochen: „ Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gebenedeit." Nun hieß es, einen geeigneten Raum für die Abhaltung des Gottesdienstes herzustellen. Zuerst stellte ich dazu mein Wohnzimmer in der Pastorat zur Verfügung. Hier und in den anstoßenden Zimmern konnten die Besucher des Gottesdienstes, wenn auch etwas gedrängt, hinein und Platz finden, sie waren wenigstens gegen Wind und Wetter geschützt. Einige Wochen später siedelten wir in das Pfarrheim über. Doch für die Dauer war das nichts, so sahen wir uns gezwungen, uns nach einem anderen Raum umzusehen. Nach längerem Hin und Her entschlossen wir uns, eine Notkirche zu bauen. Zum Glück hatte ich sofort nach Beendigung des Krieges auf Anraten von Johann Ebbert vier Militärbaracken, die auf dem Hof von Böckenhoff-Greving standen, gesichert, und als nun der Bauer Heinrich Kruse in hochherziger Weise das Material einer Scheune, die er bauen wollte, zur Verfügung stellte, konnte der Bau der Notkirche beginnen. Die Leitung übertrug ich dem Schreinermeister Alois Berger, der seine Aufgabe in glänzender Weise löste. Er entwarf einen Plan, der alle Wünsche restlos befriedigte. Es halfen ihm dabei die übrigen Schreiner der Gemeinde: Fritz Heidermann, Wilhelm Siemen, Joseph Heßling, Bernhard Hörnemann. Die Maurerarbeiten lieferte E. Demmer, ihm halfen Heinrich Limberg, Lambert Stevens. Alle, die nur eben konnten, halfen mit. Heinrich Sondermann lieferte den nötigen Sand. Sogar der alte Risthaus schaufelte mit seinen 83 Jahren noch den erforderlichen Kies aus seiner Kiesgrube. Am 15. August wurde von mir der erste Spatenstich für die Grundmauern getan, und am 15. September war der Bau soweit, daß das Richtfest gehalten werden konnte. Die ganze männliche Jugend von Westrich und Overbeck war angetreten, um beim Richten zu helfen. Nun ging es an die Innenausstattung.
|
|
|

|
| Notkirche auf der Wehme, im Hintergrund der zerstörte
Turm. daneben die Kaplanei Foto: Gemeinde St.Silvester, mit freundlicher Genehmigung von Pastor Barlage |
Der
zerstörte Turm kurz nach dem Beginn des Wiederaufbaus
Foto:
Heimatverein Erle
|
Einen eindrucksvollen Augenzeugenbericht liefert uns Gerd Buskamp, der kurz vor der Zerstörung der Kirche dort noch Erstkommunionsunterricht hatte und nur durch schieres Glück hatte Pastor Grosfeld die Kinder eine Stunde früher nach Hause geschickt. Hier gelangen Sie zu den Erinnerungen von Gerd Buskamp [9].
Pastor Grosfeld starb am 10. Dezember 1948 und konnte das Ende des Wiederaufbaus der Hauptkirche nicht mehr miterleben. Sein Nachfolger Pastor Vortmann schrieb über die Einweihung der restaurierten Kirche am 15.10.1950 in der Pfarrchronik [1]:
"Der 15. Oktober 1950 war für die Pfarrgemeinde Erle ein besonderer Freudentag dadurch, daß die durch Kriegseinwirkung zerstörte Kirche wieder ihrer Bestimmung übergeben werden konnte. Die feierliche Konsekration des Hochaltares nahm der hochwürdige Herr Weihbischof Roleff vor. [...] Gegen 11.00 Uhr feierte Pfarrer Vortmann das erste feierliche Hochamt unter Pontificalassistenz an dem neugeweihten Altare. [...] In seiner Ansprache bat der Herr Weihbischof die Gläubigen, das so herrlich neuerstandene Gotteshaus eifrig zu besuchen und zu einer Stätte des Gebetes zu machen. Nachmittags um 1/2 4 Uhr wurde das Allerheiligste in feierlicher Prozession von der Notkirche in die alte Kirche übertragen."
Nach fast fünf Jahren hatte die Notkirche ihren Dienst erfüllt. Die "Dorstener Zeitung" schrieb einen Artikel über die Einweihung der Kirche am 15. Oktober 1950 [1]:
„Gieße aus Deinen Segen über dieses Haus!
Feierliche Einweihung der wiederaufgebauten St. Silvester Pfarrkirche in Erle durch Weihbischof Roleff Münster am 15. Oktober 1950. Der gestrige Sonntag war für die Gemeinde Erle ein Tag besonderer Freude. In ihren Mauern weilte der hochw. Herr Weihbischof Roleff Münster, um die feierliche Altarweihe ihrer durch Kriegseinwirkung zerstörten, aber nach jahrelanger und unter schweren Opfern wieder aufgebauten Pfarrkirche vorzunehmen.
 |
| Der Innenraum der wiederaufgebauten Kirche am Tage der
Einweihung Foto: Gemeinde St.Silvester, mit freundlicher Genehmigung von Pastor Barlage |
 |
| Die wiederaufgebaute Kirche mit dem stumpfen Turm gleich
nach dem Kriege Foto: unbekannt |
Am Sonntagmorgen, um 8.45 Uhr, nahm die feierliche Einweihung mit der Abholung des hochw. Herrn Weihbischofs aus dem Pfarrhause seinen Anfang. Meßdiener, Engelchen, die kirchlichen Fahnen, Kirchenvorstand, Kirchenchor und die mitwirkenden Priester geleiteten den Oberhirten zur Notkirche. Nach dem Gebet der sieben Bußpsalmen vor den Reliquien, die von dem Oberhirten mitgebracht waren, zogen die Gläubigen in Prozession zur Altarweihe in die neue Kirche. Die kirchlichen Zeremonien der Altarweihe dauerten bis gegen 11 Uhr. Dann wurde nach 5 1/2 Jahren wieder zum erstenmal in der St.-Silvester-Pfarrkirche das hl. Opfer mit Pontifikalassistenz gefeiert. Bei der feierlichen Handlung sang der Kirchenchor unter Leitung von Lehrer Backenecker die vierstimmige Messe für gemischten Chor mit Orgelbegleitung von Karl Kraft.
Um 16.00 Uhr wurde dann in feierlicher Prozession das Allerheiligste aus der Notkirche zur Pfarrkirche gebracht. Auch hierbei trug der Kirchenchor durch mehrstimmige Gesänge wesentlich zu Erbauung der Gläubigen bei. Die anschließende Dankandacht beschloß den für die Erler Pfarrkinder so bedeutungsvollen Tag. Wir aber möchten unseren Bericht mit dem Wunsche schließen: „Gieße aus Deinen Segen über dieses Haus, Herr!"
|
|
| 09.05.1951:
Heinrich Limberg hat die neuen Glocken gebracht Foto: "Querbeet", Heimatverein Erle e.V. |
DIE KIRCHE 1950 BIS HEUTE
Die Kriegsfolgen sah man trotz Instandsetzung lange Zeit an. Deutlich stachen die ausgebesserten Stellen der Fassade ins Auge, die Fenster waren von recht einfacher Machart. Am Auffälligsten aber war der Turm, der sein komplettes neugotisches Aussehen verloren hatte und anstatt des hohen Turmhelms nun nur noch ein stumpfes Zeltdach, gedeckt mit roten Dachziegeln, trug. Der Innenraum war allem baulichen Schmuck beraubt, das Gewölbe wurde durch flache, weiß gestrichene Akustikdecken ersetzt, die Wände waren einheitlich weiß gestrichen, die Säulen ebenfalls, im unteren Bereich hellgrau gehalten.
|
|
|
|
| Blick auf den Chorraum Foto: Reinhard G. Nießing, mit freundlicher Genehmigung |
Blick
auf den "Turm" und die Orgelbühne Foto: Reinhard G. Nießing, mit freundlicher Genehmigung |
|
|
|
|
| Die
Kirchenorgel Foto: Reinhard G. Nießing, mit freundlicher Genehmigung |
Der
restaurierte Turm, 56m hoch Foto: Reinhard G. Nießing, mit freundlicher Genehmigung |
|
|
| Altar und Ambo,
gestaltet von Hermann Kunkler Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
|
|
| Kreus mit Tabernakel,
daneben das Ewige Licht. Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
In den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die Kirche
langsam wieder aus dem weißen Minimalismus aufgeweckt. Die
Kreuzweg-Gemälde wurden gerahmt und erhielten, durch den Erler Schmied
Hermann Buning gefertigte Wandkerzenleuchter. Dieser gestaltete auch
den großen Deckenkronleuchter vor dem Chor. Die Kirche erhielt dann
auch ihre neue Innenbemalung, die Fensterleibungen wurden farbig
eingefasst, die Säulen und die Bögen erhielten schöne, erdige Farben,
die Chorwände ebenfalls. Auch die weißen Akustikdecken wurden neu und
farbig gestaltet. Es wurde auch der historische Mittelgang wieder
installiert. Dieser ist im Laufe der Jahre durch zusätzliche Bänke
verschlossen worden. Es wurden neue, farbige Fenster eingebaut. 1991
wurde die Orgelbühne erweitert und eine neue Orgel angeschafft.
 |
x |
|
| Große
Krippe in St.Silvester Foto: Michael Kleerbaum |
Große
Krippe in St.Silvester Foto: Michael Kleerbaum |

Foto: Reinhard G. Nießing, mit freundlicher Genehmigung
Die Wiederaufbauarbeiten wurden
dann 1998-2000 durch einen gründliche Sanierung der Kirche samt
Wiederherstellung des angestammten Spitzen Turms des neugotischen Baus
soweit vorerst abgeschlossen. Dieses wurde, wie in den Jahrhunderten
vorher, erst durch die unglaubliche Spendenbereitschaft der Erler
Kirchengemeinde möglich.
|
|
|
|
| Der
Marienaltar Foto: Reinhard G. Nießing, mit freundlicher Genehmigung |
Erstkommunion
mit beflaggter Kirche Foto: Reinhard G. Nießing, mit freundlicher Genehmigung |
WISSENSWERTES
 Das älteste
erhaltene Gebäude der Kirchengemeinde St. Silvester ist das alte
Pastorat, bekannt auch als Pfarrheim. Es wurde 1790 nach dem Entwurf des Velener Baumeister Tinnefeld
errichtet. Mehr Informationen finden Sie hier.
Das älteste
erhaltene Gebäude der Kirchengemeinde St. Silvester ist das alte
Pastorat, bekannt auch als Pfarrheim. Es wurde 1790 nach dem Entwurf des Velener Baumeister Tinnefeld
errichtet. Mehr Informationen finden Sie hier.Das Ehrenmal stand nach dem zweiten Kriege auf dem Kirchplatz.
Wo sich bis zum Neubau des Jugendhauses an der Silvesterstraße der Bolzplatz der Erler Jugend befunden hat, lag der alte Friedhof von Erle. Dieser wurde 1967 geschlossen und eingeebnet.
Die auch heute noch stehende und als Wohnhaus genutzte Kaplanei wurde 1914 erbaut.
Das heutige Pastorat wurde nach Plänen des Dorstener Architekten Prof. Manfred Ludes von 1977 bis 1978 erbaut, aber bereits 1959 wurde aus dem hinteren Teil des alten Pastorats das Jugendheim und eine Begegnungsstätte für Jung und Alt und den Kirchenvereinen. 1967 ist die Erler Pfarrbücherei dorthin gezogen. Nachdem Umzug des Pfarrers wurde das ganze Pastorat zum Jugendheim ausgebaut.
Der Silvesterkindergarten wurde 1964 eingeweiht, die heutige Friedhofskapelle 1974.
Das "Gotteslob" wurde erst 1975 eingeführt.
Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, ob das Grab von Pastor Michael Spanier beim Abbruch des alten Kirchleins auf den alten Friedhof an der Silvesterstraße überführt wurde. Lediglich über den Verbleib der einfachen Grabplatte weiß man Bescheid. Er wurde zersägt und als Türstock im Pfarrheim verwendet.
Bei der Reliquie des hl. St.Silvester , die Dechant Karthaus aus Rom mitgebracht hat, handelt es sich entweder um ein keines Knochenfragment oder aber um ein Teilchen aus seiner Grabstätte, das sich seit dem 8. Jahrhundert in der römischen Kirche St. Stephani et Silvestri befindet. Diese Reliquie wurde von Dechant Karthaus kostbar in ein Reliquiar in Form eines Stehkreuzes eingefasst. Dieses Kreuz wird heute als Altarkreuz an Weihnachten, Silvester, Ostern, Pfingsten, Fronleichnam verwendet und der Priester gibt damit am Ende der Messe den Schlußsegen.
Während der Restaurierung des Turms Ende des Jahrtausends wurde natürlich auch das der Wetterhahn, das Turmkreuz und die Kugel herab geholt. Dabei stellte man fest, das anscheinend jemand Schießübungen auf die Kugel veranstaltet hat. Der Erler Clemens Heßling, der bei der Wiedererrichtung der Erler Kirche nach dem 2. Weltkrieg mitgeholfen hat, meinte sich daran erinnern zu können, das damals in der Kugel eine Urkunde gelegt worden sei. Jetzt konnte man nach über 50 Jahren nachschauen, ob die Erinnerungen von Herrn Clemens ihn nicht getrogen haben. Tatsächlich fand man in der Kugel ein sorgfältig verschlossenes zölliges Bleirohr, das ca. 12cm lang war. Dieses Rohr hatte eine deutliche Delle, die zeigte wo die Kugel des Turmschützen das Rohr getroffen hatte. Nach dem Öffnen fand man ein zersplittertes Glasfläschchen, in der die Urkunde zusätzlich verwahrt wurde. Auf der Urkunde ist zu lesen:
Urkunde
Im Jahre des Heiles 1949, als Theodor Vortmann Pfarrer von St. Silvester in Erle und Herr Wilhelm Menting stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes war, Herr Bernhard Lammersmann als Ortsbürgermeister die politischen Geschäfte führte und Fräulein Dirksen als Schulleiterin tätig war, wurde diese Kirche, die während des zweiten Weltkrieges im Jahre 1945 durch Feindeinwirkung mit Spreng- und Brandbomben bis auf die vier Umfassungsmauern völlig zerstört wurde, durch den Bauunternehmer Heinrich Fasselt aus Schermbeck wieder aufgebaut, die Zimmerarbeit von dem Schreinermeister Aloys Berger von hier ausgeführt, das Kreuz vom hiesigen Schmiedemeister Hermann Buning in eigener Werkstatt angefertigt und gestiftet, Kugel und Hahn vom hiesigen Klempnermeister Johann Nagel in eigener Werkstatt gehämmert und ausgestochen und geschenkt. Kreuz und Hahn wurden am 17. und 18. Oktober 1949 aufgesetzt.
Lobend sei noch erwähnt, daß beim Wiederaufbau der Kirche die ganze Gemeinde abwechselnd Hand- und Spanndienste geleistet hat.
Gebe Gott, daß die Gemeinde Erle, die im lebendigen Glauben an Christus dieses Kreuz errichtet hat, für alle Zeit diesem Glauben treu bleibe. Diese Urkunde wurde am 18. Oktober 1949 mit dem kirchlichen Pfarrstempel besiegelt.
Erle bei Dorsten. d. 18. Oktober 1949
Vortmann, Pfr.
Viele der hier und bei H. Lammersmann beschriebenen sakralen Gegenstände und Einrichtungsteile sind bei der Zerstörung der Kirche 1945 verloren gegangen. Trotzdem haben einige die Zeiten überstanden und sind noch heute im Besitz der Kirchengemeinde: Mehrere Meßgewänder (heute nicht mehr im Gebrauch), drei alte Kelche, zwei Ziborien (größere Kelche für die Kommunionsausteilung), die Monstranz, das Silvesterreliquiar, die Jesus- und Maria-Statue, eine Silvesterstatue (an der Wand hinten in der Kirche), daneben die leicht beschädigte Josef-Statue, die Kreuzwegbilder, das Bild der Immerwährenden Hilfe hinten im Turm (dessen kostbarer Rahmen kurz nach dem 2. Weltkrieg durch Gold- und Silberspenden der Erler Bürger hergestellten werden konnte.)
X
|
|
| Bild der
"Immerwährenden Hilfe" Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
Am Friedhofskreuz auf dem neuen Friedhof sind beerdigt: Dechant Peter Karthaus, Pfarrer Eberhard Grosfeld,
Pfarrer Theodor Vortmann, Pastor Franz-Josef Barlage. Neben
dem Kreuz ist Kaplan Georg Ording beigesetzt.
|
|
x |

|
x |

|
| Die Namen
der im 1. Weltkrieg gefallenen und vermissten Soldaten aus Erle Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
Die Namen
der im 2. Weltkrieg gefallenen und vermissten Soldaten aus Erle Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
Die Namen
der im 2. Weltkrieg gefallenen und vermissten Soldaten aus Erle Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
|
|
x |

|
x |

|
| "Hl.
Josef" Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
"Hl.
Papst Silvester" Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
"Jesus
Christus" Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
|
|
x |

|
| "Hl.
Papst Silvester" Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
"Hl. Maria" Foto: Walter Biermann, mit freundlicher Genehmigung |
| Quellen: | ||
| [1] |
Pfarrei St. Silvester: Festschrift zum 100. Jubiläum der Kirche, 1979 |
|
| [2] |
Heinrich Lammersmann: Die Merowingisch-Fränkischen Gräber in Erle 6.-8. Jahrhundert, Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck, 1926, S. 29ff |
|
| [3] |
Adolph Tibus: Gründungsgeschichte der stifter, pfarrkirchen, klöster und kapellen im bereiche des alten bisthums Münster, mit ausschluss des ehemaligen friesischen theils, Band 1,Teil 2, Münster, 1867, S. 1064 ff. |
|
| [4] |
Heinrich Lammersmann: Michael Spanier 1622-1669 (70 ?), Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck, 1929, S. 65ff |
|
| [5] |
Heinrich Lammersmann: Geschichte der Kirchenglocken zu Erle, Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck, 1931, S. 69ff |
|
| [6] |
Adalbert Friedrich/Lutz Hoffmann: De olde Hanenborg in der Erler-Mark, Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck, 1975, S. 34ff |
|
| [7] |
Heinrich Lammersmann: Landdechant Peter Karthaus zu Erle, Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck, 1929, S. 76ff |
|
| [8] |
Heinrich Lammersmann: Das goldene Priesterjubiläum des Dechanten P. Karthaus 1924, Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck, 1925, S. 92ff |
|
| [9] |
Gerd Buskamp: Erle - Erinnerungen unter der Femeiche. Kindheitsgeschichten, Bonn, 2000 |
|
| [10] |
Heinrich Lammersmann: Das alte Kirchlein 1550-1875, Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck, 1928, S. 74ff |
|
| [11] |
Ingrid Sönnert: Damals...Menschen und Geschichte(n) aus Raesfeld, Erle und Homer, Gemeinde Raesfeld, 1997, ISBN 3-9804028-1-9, S. 116ff |
|
| [12] |
Klaus Werner: Die Piuseiche in Erle, Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck., 2005, S. 199 ff |
|
| [13] |
Ingrid Sönnert: Damals...Menschen und Geschichte(n) aus Raesfeld, Erle und Homer, Gemeinde Raesfeld, 1997, ISBN 3-9804028-1-9, S. 130ff |
|
| [14] |
Johannes Gramse: 75 Jahre Erler Dorfkirche, Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck, 1954, Seite 59ff |
|
| [15] |
Prof. Dr. Albert Weskamp: Die Geschichte des Dorfes Erle und seiner Eiche, 1895 |
|
| [16] |
Hermann-Josef Buning: Die Urkunde im Kirchturm von St. Silvester, Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck, 1999, S. 138 ff. |
|